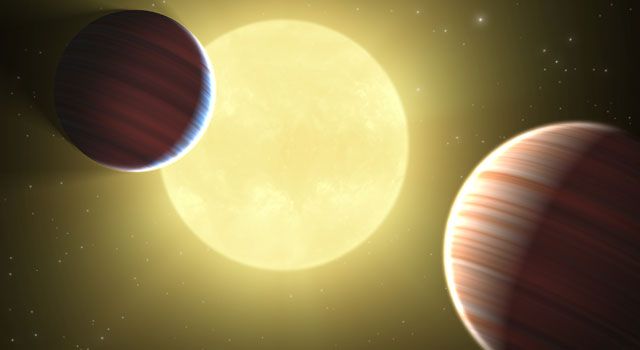
Die Kepler-Mission und deren erweiterte Mission K2 entdeckten tausende Exoplaneten. Sie registrierten sie mittels der Transitmethode. Dabei wird die Abschwächung der Helligkeit eines Sterns gemessen, während ein umkreisender Exoplanet von der Erde aus betrachtet vor ihm vorüberzieht. Transits können nicht nur die Umlaufperiode messen – oft können sie anhand der Tiefe und Form der Lichtkurve und der Eigenschaften des Zentralsterns auch die Größe des Exoplaneten bestimmen.
Die Transitmethode misst allerdings nicht die Masse des Planeten. Im Gegensatz dazu erlaubt die Radialgeschwindigkeitsmethode die Messung seiner Masse. Bei dieser Methode wird das „Wackeln“ des Zentralsterns unter dem gravitativen Einfluss eines umkreisenden Exoplaneten registriert. Den Radius und die Masse eines Planeten zu kennen, ermöglicht eine Bestimmung seiner durchschnittlichen Dichte, was Hinweise auf seine Zusammensetzung gibt.
Vor etwa 15 Jahren erkannten Astronomen des Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) und andere, dass in Planetensystemen mit mehreren Planeten der periodische, gravitative Einfluss der Planeten aufeinander ihre Orbitalparameter verändern wird. Obwohl die Transitmethode die Massen von Exoplaneten nicht direkt messen kann, kann sie diese veränderten Orbitalparameter registrieren. Diese können wiederum verwendet werden, um auf die Massen zu schließen. Kepler hat hunderte Exoplanetensysteme mit Veränderungen beim Transitzeitpunkt identifiziert. Dutzende wurden erfolgreich modelliert. Überraschenderweise schien diese Vorgehensweise eine Häufung von Exoplaneten mit sehr geringen Dichten zu finden.
Beispielsweise scheint das System Kepler-9 zwei Planeten mit Dichten von 0,42 beziehungsweise 0,31 Gramm pro Kubikzentimeter zu besitzen. Zum Vergleich: Die Erde besitzt eine durchschnittliche Dichte von 5,51 Gramm pro Kubikzentimeter und Wasser hat per Definition eine Dichte von 1,0 Gramm pro Kubikzentimeter. Der Gasriese Saturn weist eine durchschnittliche Dichte von 0,69 Gramm pro Kubikzentimeter auf. Die verblüffenden Ergebnisse werfen Zweifel auf einen oder mehrere Bereiche bei der Methode des Transitzeitpunktes und schufen lange bestehende Bedenken.
Die Astronomen David Charbonneau, David Latham, Mercedes Lopez-Morales und David Phillips vom CfA und ihre Kollegen überprüften die Verlässlichkeit der Methode, indem sie die Dichten der Planeten im System Kepler-9 mittels der Radialgeschwindigkeitsmethode maßen. Die beiden saturnähnlichen Planeten des Systems gehören zu einer kleinen Gruppe Exoplaneten, deren Massen mit beiden Methoden bestimmt werden können (wenn auch nur knapp).
Die nutzten das HARPS-N-Spektrometer am Telescopio Nazionale Galileo auf La Palma für 16 Beobachtungskampagnen. HARPS-N kann Geschwindigkeitsveränderungen mit einer Fehlertoleranz von circa 30 Kilometern pro Stunde registrieren. Ihre Ergebnisse bestätigen die sehr geringen Dichten, die mit der Transitzeitpunktmethode gemessen wurden und verifizieren die Leistungsfähigkeit der Methode, bei der die Veränderungen beim Transit registriert werden.
Abhandlung: „HARPS-N Radial Velocities Confirm the Low Densities of the Kepler-9 Planets“ von L. Borsato, L. Malavolta, G. Piotto, L. A. Buchhave, A. Mortier, K. Rice, A. C. Cameron, A. Coffinet, A. Sozzetti, D. Charbonneau, R. Cosentino, X. Dumusque, P. Figueira, D. W. Latham, M. Lopez-Morales, M. Mayor, G. Micela, E. Molinari, F. Pepe, D. Phillips, E. Poretti, S. Udry und C. Watson, MNRAS 484, 3233, 2019.
(THK)
Antworten