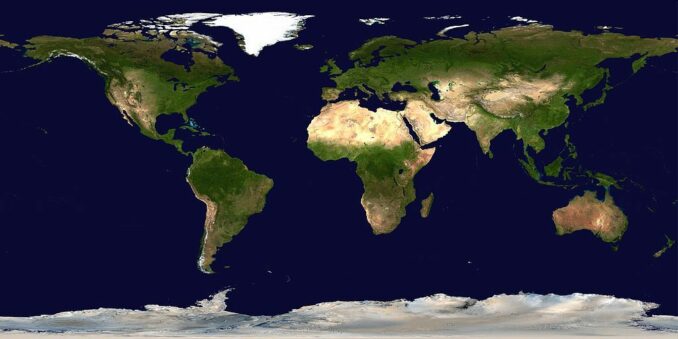
Eine neue Studie unter Leitung des Geologen Timothy Paulsen von der University of Wisconsin in Oshkosh verbessert das Wissen über die Rolle, die die Kontinente bei der chemischen Evolution der Meere spielten. Das hat Auswirkungen auf das Verständnis der Sauerstoffanreicherung in der Atmosphäre und globaler Klimaschwankungen.
Die Studie ist auf der Titelseite der Februar-Ausgabe von GSA Today, das von der Geological Society of America herausgegeben wird und neue, innovative Artikel hervorhebt, die ein breites Publikum aus dem Bereich der Geowissenschaften ansprechen.
„In dieser Veröffentlichung wird ein wissenschaftlich wichtiger Artikel erwähnt, um den Zustand der Forschung hervorzuheben“, sagte Eric Hiatt, der Vorsitzende des Geology Department an der UW Oshkosh. „Es ist eine große Ehre, dafür ausgewählt zu werden, und zeigt, dass Dr. Paulsen an vorderster Front steht, was wissenschaftliche Entdeckungen angeht.“
Das Forschungsteam analysierte eine globale Datenbank der chemischen Zusammensetzung winziger Zirkonkörnchen, die häufig in den Aufzeichnungen des irdischen Kontinentalgesteins gefunden werden. Zu dem Team gehören auch andere Wissenschaftler von der Michigan Technological University und der ETH Zürich in der Schweiz.
„Die Ozeane bedecken mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche, wodurch sie sich von den anderen terrestrischen Planeten im Sonnensystem unterscheidet“, sagte Paulsen, der Hauptautor der Studie. „Geologen wissen seit langer Zeit, dass es im Laufe der Zeit bedeutende Veränderungen an der Zusammensetzung der Ozeane gab.“
Trotzdem gibt es noch entscheidende Fragen über die Ursachen der Veränderungen der Meereschemie in der Vergangenheit, insbesondere in Bezug auf die Gesteinsaufzeichnungen im Vorfeld der Kambrischen Explosion des Lebens vor etwa 540 Millionen Jahren.
„Kontinente tendieren dazu, durch witterungsbedingte Erosion abgetragen zu werden, und Flüsse transportieren diese Sedimente zu den Ozeanen, wobei sie verstreute Puzzle-Teile zurücklassen, die von Geologen zusammengesetzt werden müssen“, sagte Chad Deering, ein Geologe der Michigan Tech und Co-Autor der Studie. „Es gibt zunehmende Hinweise darauf, dass wichtige Teile des Puzzles in den urzeitlichen Strand- und Flusssedimenten gefunden werden, die durch kontinentale Verwitterung und Erosion entstanden.“
Die Ergebnisse der Forscher basieren auf einer Analyse eines außergewöhnlich umfangreichen Datensatzes über Zirkon aus Sandstein, der aus den großen kontinentalen Landmassen der Erde stammt. Sie könnten auf wichtige Zusammenhänge bei der Evolution des Gesteinskreislaufs und der Ozeane der Erde hinweisen.
„Unsere Ergebnisse sprechen dafür, dass zwei starke Zunahmen der kontinentalen Sedimente in Flüssen die Kontinente entleerten und mit dem Auseinanderbrechen und dem Auseinanderdriften der Kontinente in Zusammenhang standen. Das verursachte eine stärkere Verwitterung und Erosion eines größeren Anteils an radioaktiven Gesteinen und der hochgelegenen kontinentalen Kruste“, sagte Paulsen.
„Beide Zeiträume hängen mit Vergletscherungen des ‚Schneeballs Erde‘ und den damit verbundenen Schritten der Sauerstoffanreicherung des Atmosphäre-Ozean-Systems zusammen. Geologen haben schon vor langer Zeit erkannt, dass die Ozeane für die Entstehung der Kontinente erforderlich waren. Ausgehend von unserer Analyse scheint es, dass die Kontinente wiederum die Ozeane, die Atmosphäre und das Klima der Erde gestalten.“
Diese Studie wurde vom Faculty Development Program der UWO finanziert. Paulsen kam im Jahr 1999 an die Fakultät für Geologie und unterrichtet Fächer wie geologische Feldmethoden, Geophysik und Geotektonik, strukturelle Geologie und Tektonik sowie Feldgeologie.
(THK)
Antworten